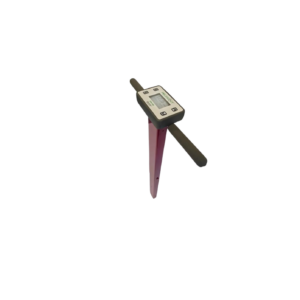Das Infektionsmodell CougarBlight, das in die Software PinovaSoft integriert ist – welche in Kombination mit der Pinova Meteo-Wetterstation verwendet wird – ist eines der wichtigsten Werkzeuge zur erfolgreichen Kontrolle dieser gefährlichen Pflanzenkrankheit.
Die Hauptkomponenten des Modells sind:
-
Krankheitsverlauf des Bakterienbrands im Obstgarten
-
Lebenszyklus der Blüte und das Wachstum der Bakterienkolonie
-
Wachstumsrate der Bakterien
-
Feuchtigkeit der Blütenoberfläche als Infektionsauslöser
Krankheitsgeschichte im und um den Obstgarten
Zwischen verschiedenen Obstgärten gibt es große Unterschiede hinsichtlich des Infektionspotenzials der Blüten und der anfänglichen Populationsgröße des Erregers auf den Narben. Diese Unterschiede stehen in direktem Zusammenhang mit der Anwesenheit, Nähe und Anzahl aktiver Krankheitsherde. In dieser Komponente wird der Anbauer aufgefordert, eines der folgenden drei Szenarien auszuwählen:
-
Im letzten Jahr gab es keinen Bakterienbrand in Ihrem Obstgarten oder in der Umgebung.
-
In der Nähe Ihres Obstgartens trat im letzten Jahr ein Bakterienbrand auf.
-
In Ihrem Obstgarten wurde im letzten Jahr Bakterienbrand festgestellt.
Es wird angenommen, dass – falls im Vorjahr Infektionen in der Nähe aufgetreten sind – einige Krebsgeschwüre möglicherweise während der Winterpflege übersehen wurden und im laufenden Jahr weiterhin als Infektionsquellen vorhanden sein können.
Wenn in der vorherigen Saison keine Infektionen in der Umgebung aufgetreten sind, geht man davon aus, dass die Infektionsschwellen schwerer zu erreichen sind, weshalb im Modell höhere Risikoschwellen verwendet werden.
Die folgenden Werte stellen die Infektionsrisikoschwellen für jedes der drei Szenarien dar:
Szenario 1
Im letzten Jahr gab es keine Infektionen in Ihrem Obstgarten oder in der näheren Umgebung.
Szenario 2
Im letzten Jahr trat eine Infektion in der Nähe Ihres Obstgartens auf.
Szenario 3
Im letzten Jahr gab es eine Infektion direkt in Ihrem Obstgarten.
| Risikostufe |
Wert (Szenario 1) |
Risikostufe |
Wert (Szenario 2) |
Risikostufe |
Wert (Szenario 3) |
| Niedrig |
0–150 |
Niedrig |
0–100 |
Niedrig |
– (nicht vorhanden) |
| Achtung |
150–500 |
Achtung |
100–200 |
Achtung |
0–100 |
| Hoch |
500–800 |
Hoch |
200–350 |
Hoch |
100–200 |
| Extrem |
800–1000 |
Extrem |
350–500 |
Extrem |
200–300 |
| Sehr extrem |
über 1000 |
Sehr extrem |
über 501 |
Sehr extrem |
über 301 |
Hinweis: Im Szenario 3 (bereits infizierter Obstgarten) existiert keine Risikostufe „Niedrig“. Jede gemessene Aktivität wird als potenziell gefährlich betrachtet.
Terminologie der Risikokategorien
Niedriges Risiko
Blütenbenetzung bei diesen Temperaturbedingungen hat in der Vergangenheit nicht zu neuen Infektionen geführt. Eine Ausnahme können Blüten in unmittelbarer Nähe (einige Meter) aktiver Infektionsherde sein.
Vorsicht
Eine Infektion durch Blütenbenetzung bei diesen Temperaturen ist unwahrscheinlich, aber das Infektionsrisiko steigt, je näher die Werte an den oberen Grenzbereich heranreichen. Wettervorhersagen und Risikowerte sollten sehr genau beobachtet werden. Falls keine Antibiotika verwendet werden, sollte der Schutz der Blüte mit anderen Mitteln drei bis vier Tage vor dem Eintritt in den Hochrisikobereich beginnen. Die schützenden Spritzungen sollten fortgesetzt werden, bis das Infektionsrisiko unter die Schwelle für hohes Risiko fällt.
Hohes Risiko
Bei diesen Temperaturwerten sind in der Vergangenheit schwere Infektionen mit Feuerbrand aufgetreten. Besonders gefährdet sind Obstgärten mit kürzlich erfolgter Infektion. Das Risiko von erheblichen Schäden steigt in den späteren Tagen der Hauptblüte sowie während des Abwerfens der Blütenblätter, wenn noch viele Blüten vorhanden sind. Infektionen sind verbreitet, aber häufig lokalisiert, wenn späte Blüten während einer Hochrisikoperiode benetzt werden. Die Infektionsstärke kann zunehmen, wenn mehrere Tage mit hohem Risiko aufeinander folgen.
Extremes oder sehr hohes Risiko
Einige der schwerwiegendsten und gefährlichsten Epidemien des Feuerbrands traten unter optimalen Bedingungen auf, gefolgt von Blütenbenetzung. Solche Infektionen führen meist zu starken Schäden im Obstgarten – insbesondere während der Hauptblüte oder wenn viele Sekundärblüten vorhanden sind. Im weiteren Verlauf der Saison bilden sich Sekundärblüten seltener, und heiße Sommertemperaturen über 35 °C verringern die Häufigkeit neuer Blüteninfektionen deutlich.
Blütenlebensdauer und Koloniewachstum
Im Temperaturbereich, der wahrscheinlich zu einer Infektion führen kann, gilt eine Blüte insgesamt vier Tage lang als geöffnet und infektionsanfällig. Wenn die Blüte mindestens zwei Stunden lang nass ist, werden die Temperaturbedingungen aller vier Tage bei der Einschätzung des Infektionsrisikos berücksichtigt. Für Birnenanbauer verlängert sich dieser Zeitraum auf fünf Tage. Studien von Thomson und Gouk (2003) sowie Pusey und Curry (2004) deuten darauf hin, dass Blüten sechs oder sogar acht Tage lang infektionsanfällig bleiben können, aber innerhalb des Temperaturbereichs, in dem die Krankheit am wahrscheinlichsten auftritt, stellen vier Tage das optimale Zeitfenster für eine Infektion dar. Birnenanbauer sollten mit fünf Tagen Wärmesumme während der Hauptblüte sowie mit einer Akkumulation über 21 Tage nach der Vollblüte rechnen.
Wachstumsrate der Bakterien
Die Temperatur hat einen starken Einfluss auf das Wachstum der Bakterien auf den Narben der Blüte. Eine Kontamination der Blüten mit dem Krankheitserreger führt nicht zwangsläufig zur Krankheitsentwicklung. Nach dem Eintreffen auf der Blüte hat die Population von Erwinia amylovora nur wenige Tage Zeit, um auf mindestens 100.000 bis 1 Million Zellen anzuwachsen, bevor sich eine mögliche Krankheit entwickeln kann. Der Erreger vermehrt sich auf den Narben der Blüten mit folgenden Raten:
-
Langsam – bei Temperaturen zwischen 15 °C und 21 °C (einige Autoren geben ein Minimum von 10 °C an)
-
Mäßig – bei 21 °C bis 24 °C
-
Schnell – bei 24 °C bis 33 °C
Das optimale Wachstum der Population findet bei Temperaturen zwischen 28 °C und 32 °C statt. Bei Temperaturen über 35 °C fällt das Wachstum abrupt ab und sinkt auf null. Die Bakterienpopulation nimmt bei jeder Temperatur über 37 °C weiter ab.
Feuchtigkeit als Auslöser der Infektion
Das Befeuchten der Blüten durch Regen, Tau (für zwei oder mehr Stunden), Sprühnebel aus Beregnungsanlagen oder jede andere Situation, die dazu führt, dass die Blüten mindestens zwei Stunden feucht bleiben, wird als potenzieller Infektionsauslöser betrachtet.
In der Praxis hängt die tatsächliche Entwicklung des Feuerbrands nach einem Feuchtigkeitsereignis während einer vom Modell als hohes Risiko eingestuften Periode davon ab, ob Blüten vorhanden sind und ob eine Kontamination mit Erwinia amylovora vorliegt.
Schutz vor Feuerbrand
Um sich bestmöglich vor Feuerbrand zu schützen, bleiben den Erzeugern neben einem Warnsystem wie der Pinova Meteo-Station nur vorbeugende Maßnahmen.
Feuerbrand lässt sich am effektivsten durch einen integrierten Ansatz kontrollieren, der Folgendes kombiniert:
-
Gartenbauliche Maßnahmen, die darauf abzielen, die Anfälligkeit der Bäume und die Ausbreitung der Krankheit zu verringern
-
Reduzierung der Inokulum-Menge im Obstgarten
-
Gezieltes Spritzen von Bakteriziden zum Schutz vor Infektionen bei bestimmten Wetterbedingungen – unterstützt durch das Prognosemodell der Pinova Meteo-Station
Gartenbauliche Maßnahmen umfassen die Auswahl weniger anfälliger Apfelsorten. Besonders anfällige Sorten sind laut amerikanischen Quellen: Crispin, Fuji, Gala, Idared, Jonathan, Monroe, Paulared, Rhode Island Greening, Rome Beauty, 20 Ounce und Wayne. Diese Sorten in Kombination mit empfindlichen Unterlagen wie M-9, Mark und M-26 stellen ein besonders hohes Risiko dar. Ein einziger schwerer Krankheitsausbruch kann zum massiven Absterben von Bäumen und erheblichen Schäden im Obstgarten führen.
Die meisten beliebten Birnensorten sind ebenfalls anfällig für Erwinia amylovora. Triebfeuerbrand tritt typischerweise bei jungem, saftigem Wachstum auf. Daher sind Schnitt- und Stickstoffdüngungsstrategien, die übermäßiges und verlängertes Triebwachstum verhindern, essenziell, um Feuerbrand einzudämmen.
Das Fortschreiten der Krankheit in die Baumkrone kann durch rechtzeitiges Ausschneiden infizierter Triebe zu Beginn des Sommers reduziert werden. Dies ist besonders wichtig bei jungen und schwachwüchsigen Bäumen, bei denen sich infizierte Triebe oft weniger als 10 cm vom Stamm befinden. Die Schnitte sollten mindestens 20–30 cm unterhalb der sichtbaren Infektionsgrenze erfolgen. Werkzeuge wie Schnittscheren sollten zwischen jedem Schnitt mit 70%igem Alkohol oder Bleichmittel sterilisiert werden, auch wenn diese Praxis begrenzt wirksam und wenig praktikabel ist.
Eine gute Kontrolle von Zikaden (Cicadidae), die die Pflanzen durch Saugen schädigen, kann entscheidend dazu beitragen, die Ausbreitung von Triebfeuerbrand zu verlangsamen.
Reduktion des Inokulums
Die Reduktion des Inokulums umfasst die Verringerung primärer Inokulumquellen wie infizierte Äste und Zweige durch Schnittmaßnahmen während der Ruhephase. Die Anwendung kupferhaltiger Fungizide/Bakterizide wird kurz nach dem Austrieb empfohlen und trägt zusätzlich zur Reduktion der aus überwinternden Krebswunden entstehenden Bakterien bei. In Obstgärten mit einer bekannten Feuerbrandhistorie sollten 1–2 Wochen nach dem Abfallen der Blütenblätter die charakteristischen gelb-orangen Triebe, die auf eine Infektion mit Erwinia amylovora hindeuten, entfernt werden. Diese Maßnahme ist besonders wirksam, wenn die Blüteninfektion gut kontrolliert wird und die Krebswunden die Hauptquelle für Sommerinfektionen darstellen. Auch das Entfernen neu auftretender infizierter Triebe kann zur Eindämmung der Krankheit beitragen. Am wirksamsten ist diese Maßnahme, wenn sie rigoros in den ersten Wochen nach der Blüte durchgeführt wird. Wird die Maßnahme verspätet durchgeführt, wenn bereits zahlreiche Infektionen sichtbar sind, ist ihre Wirksamkeit stark eingeschränkt. Das Schnittmaterial sollte sachgemäß gesammelt und durch Verbrennen unschädlich entsorgt werden. Wiederverwendbare Werkzeuge müssen in geeigneten Desinfektionsmitteln (70 % Alkohol oder Bleichmittel) gereinigt werden.
Bakterizide Spritzung
Die schwerwiegendsten Feuerbrand-Epidemien beginnen in der Regel mit Blüteninfektionen. Bestimmte Antibiotika können – mit Sondergenehmigung – wirksam gegen Infektionen schützen, wenn sie kurz vor oder direkt nach einer potenziellen Infektion appliziert werden. Verschiedene Prognosemodelle, darunter CougarBlight, wurden entwickelt, um den optimalen Zeitpunkt für solche Anwendungen zu bestimmen. Die meisten Modelle basieren auf folgendem Prinzip:
-
Eine bestimmte Menge an Temperatursummen muss sich während der Blüte akkumulieren, bevor der Infektionsschwellenwert erreicht ist.
-
Danach ist Feuchtigkeit (z. B. Regen) entscheidend, um die Bakterien zu den Eintrittsstellen zu spülen.
Daher sollten Antibiotika unmittelbar vor (oder nach) einem Regenereignis eingesetzt werden, wenn der Schwellenwert überschritten wurde.
Der routinemäßige Einsatz von Antibiotika zur Eindämmung von Sommerinfektionen ist nicht wirksam und wird nicht empfohlen. Die Anwendung zur Desinfektion frischer Wunden unmittelbar nach einem Hagelschlag kann jedoch sehr nützlich sein.
Wenn der Infektionsschwellenwert überschritten wurde, sollte vor dem nächsten Feuchtigkeitsereignis mit bakterizid wirkenden Mitteln gespritzt werden.
Radikale Bekämpfungsmaßnahmen
Die wirksamste Maßnahme zur vollständigen Eliminierung von Feuerbrand ist das Roden und Verbrennen infizierter Obstgärten. In intensiven Anbauanlagen wird dies jedoch nur durchgeführt, wenn ein sehr hoher Prozentsatz der Bäume betroffen ist.